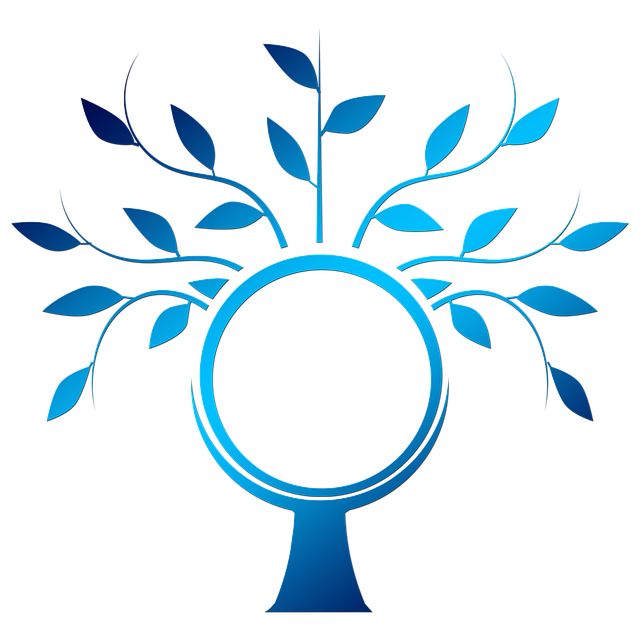Für wiederaufladbare Energiespeicher gibt es einen großen Markt. Die verschiedenen verfügbaren Akku-Typen haben ihre Vor- und Nachteile und werden in zahlreichen unterschiedlichen Fahrzeugen und Geräten eingesetzt. Insbesondere die Elektrifizierung der Mobilität hat zu entscheidenden Weiterentwicklungen in diesem Bereich geführt. Neben den bekannten und weit verbreiteten Lithium-Ionen-Akkus rücken alternative Technologien in den Vordergrund. Dieser Beitrag informiert darüber, welche Akku-Typen erhältlich sind und welche Weiterentwicklungen in der Akkutechnologie zu erwarten sind.
Woran erkennt man gute Akkus?
Für Industrie und Verbraucher sind moderne Akkus unentbehrlich. Ob im Handy oder als Batteriespeicher für die Solaranlage, Akkutechnologie trifft man überall an, wo Energie gespeichert werden muss. Wichtige Qualitätskriterien für Akkus sind Lebensdauer, Leistungsstärke, Sicherheit und kreislaufwirtschaftlicher Nutzen. Je nach Einsatzbereich legen die verfügbaren Akku-Typen den Schwerpunkt auf einzelne dieser Kriterien. Man unterscheidet die folgenden Akku-Typen:
- Lithium-Ionen-Akkus
- Lithium-NMC-Akkus
- Lithium-Ion-Polymer-Akkus
- Blei-Vlies-Akkus
- Lithium-Eisenphosphat-Akku
- Natrium-Ionen-Akkus
- Nickel-Cadmium-Akkus
- Festkörperbatterien
Aus Sicherheitsgründen sind Nickel-Cadmium-Akkus inzwischen vom Markt genommen worden. Die übrigen Akku-Arten sind hingegen weiterhin relevante Energieträger und werden durch physikalische Forschung laufend weiterentwickelt.
Lithium-Ionen-Akkus
Lithium-Ionen-Akkus gehören zu den am häufigsten im Alltag genutzten wiederaufladbaren Energiespeichern. Für sie gibt es ein breites Einsatzspektrum von Elektrofahrzeugen bis hin zu tragbaren Elektrogeräten. Der Vorteil von Lithium-Ionen-Akkus ist, dass sie energieeffizient sind und günstig hergestellt werden können. Mit ihrer hohen Energiedichte sparen sie Platz und Gewicht. Ferner zeichnen sie sich durch eine geringe Selbstentladung aus und verfügen über eine lange Lebensdauer mit zahlreichen Lade- und Entladezyklen. Allerdings führen Lithium-Ionen-Akkus immer wieder zu Bränden, wenn sie über den Hausmüll entsorgt werden. Des Weiteren sind die empfindlich gegenüber Überladung und Tiefentladung. Da Rohstoffe wie Kobalt, Nickel und Lithium benötigt werden, ist die Herstellung nicht besonders nachhaltig.
Lithium-Eisenphosphat-Akkus (LFP)
LFP-Akkus findet man in Energiespeichersystemen, Fahrzeugen und Elektrogeräten. Sie bieten eine lange Lebensdauer und eine hohe Sicherheit, weil sie über eine gute chemische und thermische Stabilität verfügen. Durch ihre konstante Entladespannung ergibt sich im Gebrauch keine wesentliche Leistungsminderung. Allerdings haben LFP-Akkus eine geringe Energiedichte, weshalb sie mehr Platz als Lithium-Ionen-Akkus beanspruchen. Zudem sind sie aufgrund von Material und Verarbeitung relativ teuer.
Lithium-Polymer-Akkus
Im Unterschied zu Lithium-Ionen-Akkus verwenden Lithium-Polymer-Akkus gelartige oder feste Elektrolyte. Verwendet wird diese Akku-Art vor allem in Elektrofahrzeugen, Drohnen und Elektrogeräten. Ihr Vorteil ist die flexible und anpassungsfähige Bauform. Darüber hinaus haben Lithium-Polymer-Akkus eine hohe Energiespeicherdichte und eine geringe Selbstentladung. Als Nachteile sind die hohen Fertigungskosten und die begrenzte Lebensdauer zu nennen. Des Weiteren sind Lithium-Polymer-Akkus empfindlich gegenüber Hitze und Kurzschlüssen.
Nickel-Metallhydrid-Akkus (NiMH-Akkus)
NiMH-Akkus findet man in industriellen Anwendungen und in Haushaltsgeräten. Sie sind robust, umweltfreundlich und haben eine starke Energiedichte. Ferner zeichnen sich NiMH-Akkus durch eine geringe Selbstentladung, Kosteneffizienz und Langlebigkeit aus. Außerdem sind sie in den verschiedensten Baugrößen erhältlich. Nachteilig ist hingegen ihre geringe Energiedichte. Überdies sind NiMH-Akkus empfindlich gegenüber Temperaturschwankungen. Bei Überhitzung drohen Explosions- und Brandgefahr.
Natrium-Ionen-Akkus
Natrium-Ionen-Akkus gelten als umweltfreundliche und nachhaltige Alternative zur Lithium-Technologie. Natrium ist als Rohstoff in großen Mengen verfügbar und verursacht weniger Umweltschäden bei der Förderung und Verarbeitung. Überdies sind Natrium-Ionen-Akkus wenig anfällig für Temperaturveränderungen. Ferner bieten sie Vorteile in den Bereichen Sicherheit und Haltbarkeit. Allerdings verfügt diese Akku-Art über eine geringe Energiedichte und beansprucht daher mehr Platz an Lithium-Ionen-Akkus.
Technologische Innovationen in der Akkuforschung
Nachhaltige Batterien werden auf dem Markt immer mehr nachgefragt. Deshalb experimentiert die Forschung mit alternativen Elektrolyten. Natrium-Ionen-Akkus sind inzwischen zu einer echten Alternative zur Lithium-Technologie geworden. Auf der Grundlage eines günstigen und umweltfreundlichen Rohstoffs erzielen diese Akkus eine hohe Leistung und Lebensdauer. Sie erreichen inzwischen bis zu 50.000 Ladezyklen. Allerdings verhindert die geringe Energiedichte die Nutzung in Elektrofahrzeugen. Mit Weiterentwicklungen wartet auch die Festkörpertechnologie auf. Festkörper-Batterien bieten eine größere Sicherheit und eine besonders schnelle Aufladung. Die Gefahr von Auslaufen und Bränden ist deutlich minimiert. Moderne Festkörperbatterien ermöglichen die volle Aufladung eines Elektrofahrzeugs in rund 20 Minuten. Auch die Kapazität ist beeindruckend, denn mit einer Ladung kann man bis zu 640 Kilometer zurücklegen. Festkörperbatterien für Elektrofahrzeuge werden in Kürze marktfähig sein. Noch nicht ganz so weit sind Halbleiterbatterien, an denen japanische Automobilhersteller zurzeit forschen.
Die Herausforderung des Recyclings
Eine große Herausforderung für Forschung und Industrie ist die Verbesserung des Recyclings der verfügbaren Akku-Typen. Das mechanische Zerteilen und das Sortieren der einzelnen Batteriebestandteile erfordern neue Technologien, um die Wiederverwertung wirtschaftlich zu gestalten. Zugleich muss das Recycling Sicherheit und Qualität gewährleisten. Angesichts der Elektrifizierung von Mobilität und Wärmegewinnung wird sich die Nachfrage nach knappen Rohrstoffen für die Akku-Herstellung absehbar steigern und somit auch der Preis. Der Automobilhersteller Mercedes Benz ist deshalb bereits dazu übergegangen, mit einem mechanisch-hydrometallurgischen Verfahren einen Batterie-Wertstoffkreislauf zu schaffen. Aber auch das Recycling gewöhnlicher Haushaltsbatterien wird von großen Entsorgungsunternehmen bereits in Angriff genommen. In Europa werden zurzeit 50.000 Tonnen Lithium-Ionen-Batterien jährlich recycelt. Es ist eine erhebliche Kapazitätssteigerung nötig, denn bis 2030 werden 700.000 Tonnen Altbatterien anfallen. 2040 werden voraussichtlich 2,1 Millionen Tonnen Altbatterien im Jahr sein.